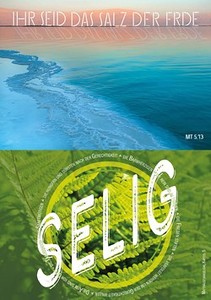Matthäusevangelium
Der Verfasser schreibt ein „Buch über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, des Nachkommens Davids und Abrahams“ (Mt 1,1). An den Beginn seines Evangeliums stellt er unterschiedliche Vorgeschichten: Sie geben Aufschluss über die wahre Herkunft Jesu und über die Ablehnung und Verfolgung durch das eigene Volk. Die Predigt des Täufers sowie die Taufe am Jordan und die Erprobung Jesu werden als Weiterführung der ausführlichen Einleitung (oder Hinführung) dargestellt.
Die Kompositionsweise des Evangelisten erschließt sein theologisches Konzept. Der Verfasser nutzt für seine ganze Schrift eine Blocktechnik: Er stellt die Verkündigung nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammen. Wie die fünf Bücher des Mose hat auch Matthäus fünf große Redekompositionen (Bergrede: Mt 5,1–7,29; Aussendungsrede: Mt 9,35–11,1; Gleichnisrede über die neue Welt Gottes: Mt 13,1–53; Gemeinderede: Mt 18,1–35; Rede über die Endzeit: Mt 24,1–25,46). Sie bilden kompakte thematische Zusammenstellungen zu Grundbereichen der Jesusverkündigung und des Lebens der Gemeinde(n) des Matthäus. Als solche stellen sie das inhaltliche Rückgrat dar, um das herum der weitere Verlauf der Jesusgeschichte erzählt wird. So wird im umfangreichsten Teil des Evangeliums das Wirken Jesu in Wort und Tat entfaltet (Mt 4,17–18,35). Der Weg nach Jerusalem (Mt 19,1–20,34) bildet den Übergang zum konfliktreichen Aufenthalt Jesu in dieser Stadt (Mt 21,1–25,46). Abschließender Höhepunkt der Schrift ist die Erzählung über das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu, verbunden mit dem Ausblick auf die Zeit der Kirche (Mt 26,1–28,20).
Der Evangelist weist nach, dass Jesus von Nazaret der Sohn Davids ist, der in den heiligen Schriften Israels verheißene Christus (vgl. Mt 1,1–17). Da seine Gemeinden großteils judenchristlich geprägt sind, ist es ihm ein besonderes Anliegen, Argumente gegenüber der jüdischen Umgebung aufzuzeigen. In den Erfüllungszitaten wird auf die heiligen Schriften Israels, also unser Altes Testament, verwiesen. Jesus wird als der neue Mose gezeichnet, der wie der Lehrer schlechthin das erneuerte Volk Gottes vom Berg aus lehrt (vgl. Mt 4,25–5,2) und der in der Interpretation der Weisung Gottes unerhörte eigenständige Autorität besitzt: Nicht um die buchstäbliche äußere Erfüllung geht es, sondern um die innere Haltung, die dahintersteht; deswegen wird auf das Hören und „Tun“ der Weisung besonderer Nachdruck gelegt.
Die Schrift wendet sich an Gemeinden, die um 85 n.Chr. bereits in Distanz zum Judentum lebten und über deren Grenzen hinausgewachsen waren (vgl. bes. Mt 28,16–20). Der Verfasser möchte mit seiner Schrift den Gemeinden helfen, sich in einer Kirche von Glaubenden aus dem Judentum und dem Heidentum zurechtzufinden.
Das Evangelium ist ursprünglich in griechischer Sprache entstanden. Es wurde von einem namentlich unbekannten Judenchristen verfasst. Ab dem 2. Jahrhundert wird als Verfasser „Matthäus“ angegeben. Der Evangelist zieht für seine Schrift verschiedene Quellen heran, insbesondere das Markusevangelium.
Diese Einleitung (Download) ist dem Buch Das neue Testament in der Sprache unserer Zeit entnommen.
Minibibel – Matthäusevangelium
Als ideale Begleiterin durch das Matthäus-Jahr verführt die Minibibel dazu, das Evangelium einmal als Gesamtes zu lesen und selbst wahrzunehmen, welche Schwerpunkte dieser Evangelist bietet. Außerdem findet sich darin ebenfalls eine kurze Hinführung zum Matthäusevangelium und einige Tipps zur Verwendung der Minibibel.
Das Matthäusevangelium hat Platz in jeder Tasche, ist ein Begleiter für Reisen und für zwischendurch und kann auch als sinn-volles Geschenk für Bibelinteressierte und solche, die es noch werden könnten, Verwendung finden.